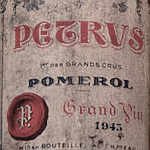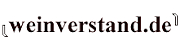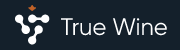SUB ROSA – ENTDECKUNGSREISE
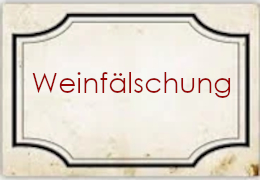
Die meisten Châteaux und Domänen verwenden als Schutz vor Fälschungen mindestens zwei Druckverfahren. Metallische Farbe darf nicht auf einen normalen Druck darübergebürstet sein. Laserdruck macht sich im Mikroskop durch seine Plastik-Anmutung kenntlich, InkjetDruck verrät sich in der Vergrößerung durch kleinste Spritzer, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind.
Weitere Hinweise geben das Alter des Papiers, Wasserzeichen und Strich. Verdächtig sei es auch, wenn sich Leimspuren in Risschen des Papiers finden, dann sei das Etikett bereits gerissen gewesen, als es auf die Flasche geklebt wurde: einer unter vielen Versuchen, Papier auf mehr oder weniger fadenscheinige Weise auf „alt“ zu trimmen. Andere Versuche, dies zu erreichen, sind das Aufdrucken von Stockflecken aufs Etikett oder das Auftragen von Schellack, um eine Keller-Patina vorzutäuschen. Prinzipiell sei die Akuratesse, mit der ein echtes Etikett gedruckt sei, bei der Nachahmung kaum zu erreichen. So verraten kleine Ungenauigkeiten im Druckbild die Fälschung. Allerdings ist sehr viel Erfahrung vonnöten, um die je Weingut aussagekräftigsten Details zu kennen und zu bewerten.
Prinzipiell existieren drei Arten der Fälschung: die komplette Reproduktion einer Flasche, die Wiederbefüllung einer ausgetrunkenen echten, und so genannte „Einhörner“ – das sind Artefakte von Weinen, die nie existiert haben, wie die berühmten Clos Saint-Denis 1945, 1959 und 1962 der Domäne Ponsot, die maßgeblich zum Fall von Rudy Kurniawan beigetragen haben. Bekanntlich hat die Domäne ihren Anteil am Clos Saint-Denis erst anfangs der 1980er Jahre erworben.
TEXT: © weinverstand.de | Bericht über Maureen Downey
 IN
VINO VERITAS –
IN
VINO VERITAS –